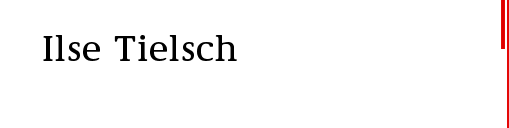
Manchmal ein Traum,
der nach Salz schmeckt
Gesammelte Gedichte
Nachwort von Christian Teissl
EINIGE ÜBERLEGUNGEN ZUR LYRIK VON ILSE TIELSCH
Innerhalb der österreichischen Literatur weiß ich keinen Text, der die Verstörung einer ganzen Generation dermaßen bündig auf den Begriff bringen würde wie Ilse Tielschs Gedicht „Schriften und Farben“ (aus ihrem Band „Regenzeit“). Wie fast immer in ihrer Lyrik, die sich nicht an ein exklusives Publikum aus Kennern und Kollegen, professionellen Lesern und Interpreten wendet, sondern an eine bunt zusammengewürfelte Leser- und Zuhörerschaft, verzichtet die Autorin auch hier auf alle dunklen Metaphern zugunsten einer Diktion, die klar ist wie Wasser, kommt sie auch hier mit wenigen Worten aus, nimmt mit knappen, kurzen Versen vorlieb – einzelne Verse dieses Gedichts bestehen lediglich aus einem einzigen Wort –, und beschränkt sich auf ein allgemein gängiges, eingängiges Vokabular. Exemplarisch zeigt sich an diesem Gedicht aber auch noch eine weitere Qualität dieser Lyrikerin, nämlich ihre Fähigkeit, aus zartestem Sprachgewebe ein denkbar stabiles, leicht und gut begehbares Gebäude zu errichten, ohne dabei auf strophische Gliederungen zurückgreifen zu müssen. Torbogenförmig wölbt sich das Versgebilde, um schließlich in einem markanten Schlussstein zu kulminieren:
Unsere Kindheit
war gotisch gedruckt
die Zukunft
arabisch berechnet
die Zeit
lasen wir römisch
von den Turmuhren
ab
hoch
über unserem Schlaf
hing der Sichelmond
kurrent geschrieben
die Angst
schlich in Einheitskurzschrift
durchs Schulhaus
später den Tod
setzten wir sauber
latein
Nacht für Nacht
wechselte die Farbe
der Fahnen
die Farben von
Druckerschwärze
und Blut
blieben
gleich
Ohne Klage und Anklage, ohne jeden Anflug von Pathos wird hier Rückschau gehalten auf eine Kindheit, die, bedingt durch Diktatur und Krieg, ein jähes, vorzeitiges Ende nahm, wird hier die Bilanz einer kurzen, zerbrochenen Jugend gezogen, die durch traumatische Verlusterfahrungen, durch Flucht und Vertreibung geprägt und gezeichnet war. Noch längst nicht erwachsen geworden, erlebten die Angehörigen dieser Generation auf die eine oder andere Weise den gewaltsamen Zerfall von allem, was sie für „ihre Welt“ gehalten hatten, mussten sie erkennen, dass vieles von dem, was man ihnen in der Schule beigebracht hatte, nun keinerlei Gültigkeit mehr besaß, dass viele der Heilsgewißheiten, auf die man sie eingeschworen hatte, monströs unmenschliche Lügen gewesen waren und viele ihrer größten Hoffnungen nichts weiter als Illusionen. Die Konsequenz, die nicht wenige von ihnen daraus gezogen haben, war radikale Skepsis allen großen Worten, allen großen Erzählungen und großspurigen Welterklärungen gegenüber, war ein nimmermüdes Mißtrauen, das sich nicht nur auf die bestehenden Verhälnisse beschränkte, sondern auch vor dem eigenen Ich, dem eigenen Verhalten und der eigenen Weltwahrnehmung nicht Halt machte.
Einer der frühesten Texte Ilse Aichingers, veröffentlicht 1946 in der Zeitschrift „Plan“ trägt den emblematischen Titel „Aufruf zum Mißtrauen“ und gipfelt in dem folgenden Appell: „Wir müssen uns selbst misstrauen. Der Klarheit unserer Absichten, der Tiefe unserer Gedanken, der Güte unserer Taten! Unserer eigenen Wahrhaftigkeit müssen wir misstrauen!“ Ein Programm, das großen Widerhall gefunden und tiefe Spuren hinterlassen hat in der literarischen Arbeit, der poetischen Praxis vieler Autorinnen und Autoren dieser Generation; so auch in der Lyrik Ilse Tielsch, die nicht etwa wie ein erratischer Block in der österreichischen Literarturlandschaft steht, sondern zahlreiche Parallelen und Verwandtschaften aufweist zur Lyrik etwa einer Jeannie Ebner, einer Doris Mühringer oder einer Christine Busta.
Jede dieser Autorinnen hat das Ihre dazu beigetragen, die nach Faschismus und Krieg verwüstete, durch Propaganda verzerrte und ihrer menschliche Würde entkleidete Sprache wieder bewohnbar zu und fruchtbar machen. Jede dieser Dichterinnen war traditionsbewusst, aber nicht traditionshörig; von den althergebrachten, ererbten lyrischen Formen lösten sie sich spätestens im Laufe der 1960er Jahre, doch am Mitteilungscharakter der Sprache und an der Notwendigkeit, den Dingen einen Namen zu geben, und sei es einen gänzlich neuen, hielten sie unbeirrt fest. Jede von ihnen lieferte poetische Bestandsaufnahmen der eigenen Gegenwart, Zeitdiagnosen in einer zeitlosen Sprache. Christine Busta etwa verstand es, aus den Erfahrungen ihrer Generation und ihrer eigenen Biographie heraus, den „Besitz des Menschen“ mit den folgenden drei Zeilen zusammenzufassen:
Was ist uns geblieben? Zu Häupten die Sterne, die unnahbar fremden,
unter den Füßen die Toten, das wilde, kindliche Gras
und im Herzen die Schuld, die ruhlos lebendige.
Eine ähnliche Inventur unternahm Ilse Tielsch in ihrem Gedicht „Was mir gehört“, in dem sie auflistet, was ihr geblieben ist und wessen sie sich halbwegs sicher sein kann:
Dieser Tisch
dieser Stuhl
dieser Frühling
dieses scharf geschliffene Messer
dieser tote Fisch auf dem Teller
dieses Brot
dieser Herzschlag
dieser Augenblick Liebe (...)
In der Lyrik dieser Autorin sucht man große Gesten vergeblich. Sich in Pose zu werfen und sich verschiedene Sprachmasken anzulegen hatte sie zu keiner Zeit nötig. Auch suchte sie nie mit virtuoser Sprachartistik, mit Wort- und Silbenakrobatik aufzutrumpfen, sondern ging auf denkbar redliche Art und Weise daran, zu erkunden, was sich nach all den stattgehabten Katastrophen noch sagen ließ, welche Wege kreuz und quer durch die Sprache man noch betreten konnte, ohne im Klischee oder in der wohlfeilen Phrase zu landen. Billige Abstraktionen meidet sie konsequent; selbst eine Überschrift wie „Besitz des Menschen“ wäre für ihre Begriffe, ihre Sprachverhältnisse zu abstrakt, zu allgemein gehalten. Anstatt selbstbewusst „der Menschheit“ ein Zeugnis auszustellen, legt sie voller Selbstzweifel, voller Zweifel an ihrer Sicht der Dinge und an der Sinnhaftigkeit ihres schriftstellerischen Tuns Zeugnis ab von ihrem Leben als schöpferischer Mensch in einer verwalteten, verzweckten Welt. Sie beansprucht für sich keinen Sonderstatus, behauptet nicht, über exklusives Wissen oder visionäre Gaben zu verfügen, wie man sie den Dichtern seit altersher gerne zuschreibt, sondern versteht sich als Teil eines großen, unentwirrbaren und unauflöslichen Ganzen, als solidarisches Mitglied einer Überflussgesellschaft, deren gravierende Mängel – wie etwa Lieblosigkeit und Sprachlosigkeit – offenkundig sind. Die berufsbedingte Isolation hat bei ihr nie zu übersteigerter Selbstbezüglichkeit, nie zur literarischen Nabelbeschau geführt; immer blieb die Frage nach dem anderen im Vordergrund, nach dem Leben der anderen, immer hielt sie Ausschau nach einem Menschen in ihrer Umgebung (fern hinter Schleiern/ ein Licht/ dort atmet einer/ wie ich), der, in ungleich tiefere Isolation verstrickt, auf ein Zeichen wartet, ein Signal, eine Nachricht, die sein Leben verändert.
Anteil zu nehmen am Leben, sich in die Not der anderen hinein zu versetzen ist der Autorin ein tiefes Bedürfnis, das sie fortwährend in Atem hält. Viele ihrer Gedichte sprechen davon, sprechen aber auch von den Hürden und Schranken, die errichtet sind zwischen Mensch und Mensch, zwischen Nachbar und Nachbar, und von der oftmals vergeblichen Mühe, gegen sie anzurennen und sie zu Fall zu bringen. Das Ich, das sich in diesen Versen artikuliert, weiß sich emotional mit vielen Freunden und Fremden, Lebenden und Toten, Vertrauten und Namenlosen untrennbar verbunden, täuscht sich aber auch nicht mithilfe einer plakativen, alles und jeden umarmenden Geste der Weltverschwisterung darüber hinweg, dass der andere, der Nachbar, verpuppt und verkapselt in seiner Not nur allzu oft unerreichbar ist, dass der Vers keine Brücken bauen kann zu jenem fremder Kontinent, der auf der anderen Seite der Straße, im „Wohnblock mir gegenüber“ beginnt.
Wie in allen übrigen Belangen gibt sich Ilse Tielsch auch hier keinerlei Illusionen hin. Sie weiß, dass der Zuspruch in Versen meist dazu verurteilt ist, Selbstgespräch zu sein, dass die Distanz zum „fremden Bruder“ wohl mühelos in Gedanken und Versen, in der Phantasie und auf dem Papier, nur selten aber in der Realität des Alltags überwunden werden kann und jedes noch so aufrichtige Mitgefühl Gefahr läuft, zum bloßen Wunschdenken, zur hehren Idealvorstellung zu geraten:
Täglich
kommen mit der Post
auch ungeschriebene Briefe
ich trage sie mit den anderen ins Haus
Briefe aus fernen Erdteilen
aus mir unbekannten Gegenden jedenfalls
zum Beispiel aus den Wohnblöcken gegenüber
an mich gerichtete Botschaften
der Einsamkeit und der Not
tief bewegt und voll Mitgefühl
mit dem aufrichtigen Wunsch
den Absendern beizustehen
biete ich meine sofortige Hilfe an
und schweige meine Antworten
sie werden niemanden erreichen
*
Ilse Tielschs jüngster Gedichtband trägt den bezeichnenden Titel „Lob der Fremdheit“. Das Lob, der Lobgesang gehört seit eh und je zu den zentralen Funkionen der Poesie, und hält man Umschau in der österreichischen Lyrik des 20. Jahrhunderts, so findet man ein „Lob der Vergänglichkeit“ (Hans Leifhelm), einen „Lobgesang auf diese Zeit“ (Henz), ein „Lob des Dunkels“ (Szabo) und ein „Lob der Verzweiflung“ (Kramer) – samt und sonders eigentümliche, bemerkenswerte Versuche, das Geächtete zu achten und das Erdrückende zu überhöhen. In diese Reihe gehört auch der Lobgesang von Ilse Tielsch, und dafür, dass dass sie ihn uns geschenkt hat, sind wir ihr zu tiefem Dank verpflichtet, gerade hier und heute, in einem Land, in dem das Fremde fast nur im Gewand des Exotischen, des Außergewöhnlichen begrüßt und akeptiert wird, nicht aber als integraler, unentbehrlicher Bestandteil des eigenen Alltags.
Das Lob der Fremdheit stimmte die Dichterin bereits in einem Gedicht ihres ersten, 1964 erschienenen Bandes „In meinem Orangengarten“ an. Es portraitiert nicht so sehr eine fremde Stadt als dass es die erste Begegnung mit ihr, die erste Erkundung ihrer Straßen, Gassen, Gebäude, ihrer Aromen und ihrer Atmosphäre skizziert:
Noch
ist die Luft dieser Stadt
unberührt
von meinem Atem
und dem Atem derer,
die ich kenne.
Noch
sind ihre Türschwellen
unbetreten
von meinen Schuhen
und die Hauseingänge
geben Rätsel auf.
Noch
sind die Brücken dieser Stadt
zwischen Ufern gespannt,
die keine Namen tragen,
doch ihre Türme
legen sich schon Schleier
der Vertrautheit
um die Schultern
und der orangefarbene
Hügelhorizont
besitzt mich schon
ganz –
Nur auf fremdem Terrain sind Entdeckungen möglich; nur solange noch keine „Schleier der Vertrautheit“ sich um die Dinge legen, ist man fähig, ihnen auf den Grund zu sehen und ihnen schauend, wahrnehmend, Gerecht zu werden. Wer heimisch ist, weiß Bescheid – oder glaubt Bescheid zu wissen – und ist ein Gefangener seines Wissens; wer aber fremd ist, geht mit offenen Augen durch seine Tage und Nächte und bekommt eine Ahnung von allem. Gerade die Ahnung aber ist es, die den Horizont offen hält und die Welt weit macht (um mit Peter Handke zu reden), während alles vermeintliche oder tatsächliche Wissen, alle eingeübten Definitionen, alle verinnerlichten Dogmen und Gewißheiten den Blick verengen, den Spielraum, den Atemraum einschränken.
Die Sehnsucht heimisch zu werden, irgendwo, in menschlicher Umgebung, ist ebenso unauslöschlich wie unstillbar und gehört zur conditio humana. Die Suche nach einer Heimat ist und bleibt eine große Lebensaufgabe, die dem Seßhaften genauso aufgetragen ist wie dem modernen Nomaden. Ob man nun wie Ilse Tielsch bereits in jungen Jahren eine Heimat, ein Zuhause, in dem man sich geborgen fühlte, unwiederbringlich verloren hat oder ob einem die Menschen und Verhältnisse, unter denen man groß wurde, von Anfang an das unabweisbare Gefühl einflößten, in eine fremde Haut gebannt zu sein, zutiefst unbehaust und unzugehörig, über kurz oder lang begibt man sich auf die Suche, und solange man sucht, kann man noch allemal ein anderer werden, verfügt man noch über „einen dünnen Faden Hoffnung“, den Ilse Tielsch in dem oben zitierten Inventurgedicht zu ihrer unverlierbaren Habe zählt. Um an ihm festzuhalten und ihn nicht preis zu geben, empfiehlt es sich, allen ach so bequemen Gewöhnungen, allen Denk- und Sprechgewohnheiten auszuweichen und ein Fremder, eine Fremde zu bleiben:
Gewöhne dich nicht
an die Sprache
gewöhne dich nicht
an die Gegend
gewöhne dich nicht
an dein Haus.
An den sanften Schnee
gewöhne dich nicht
der vor den Fenstern fällt
gewöhne dich nicht
an Namen
gewöhne dich nicht
an ein Gesicht.
Ilse Tielsch hat sich nie an das Gegebene, Vorgegebene gewöhnt, weder an das Bittere noch an das Schöne, weder an die Wörter und ihre Bedeutungen noch an den Unsinn, mit dem wir Tag für Tag von allen Seiten und aus allen Kanälen überflutet werden. Deshalb birgt jeder Tag für sie immer noch einen neuen Anfang und jeder Vers führt sie ins Offene, wohin wir ihr nur allzu gerne folgen.
Rezensionen »
