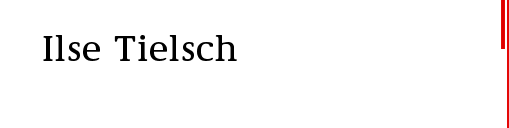
Von der Freiheit schreiben zu dürfen
Stimmen zum Buch:
Hahnrei Wolf Käfer
Gegen Intoleranz und Hass
Ilse Tielsch hat, ohne es zum Programm zu erklären, ein solches; der hier als Überschrift gewählte Satz, übrigens auch einer ihrer Aufsatztitel, kann als Kurzfassung genommen werden. Freilich ist diese Autorin viel zu sehr Dichterin, es wäre Beleidigung und Abwertung, sie auch nur in die Nähe von Agitatoren, Predigern oder Programmschreibern zu rücken. Was Ilse Tielsch auszeichnet, ist eher als Haltung zu bezeichnen, eine vor allem auch in dieser Konsequenz heute recht seltene Lebens- und Schreibart. ‘Hineingeboren in eine Epoche, die für ein menschliches Gehirn auf kaum fassbare Weise durchtränkt ist von entsetzlichem Geschehen. in dem nichts, aber auch wirklich nichts von dem nicht verübt worden ist, was Menschen ihresgleichen antun können...’ sagt Ilse Tielsch in einer Rede, um später fortzusetzen ‘Hineingeboren jedoch glücklicherweise auch in eine von Kunst aller Ausdrucksformen bestimmte familiäre Umwelt...’ Dieses erlebte Wissen, diese Bewusstheit um Zweiseitigkeit und Wechselspiel des Daseins macht das Besondere dieser Autorin, die trotz ihrer Biographie als Sudetendeutsche und Vertriebene nie den Versuchungen des Ressentiments verfallen ist. An ihren Texten ist herrlich zu studieren, wie Haltung und Schreibform so zum Synonym Stil verschmelzen, Stil, der sich nicht in der Sprache, und schon gar nicht in irgendwelchen Spracheitelkeiten, und auch nicht in Marotten des Auftretens erschöpft, sondern sich als etwas aus dem Inneren der Persönlichkeit zutage Tretendes erweist.
In dem neuen, bei Driesch aufgelegten Büchlein ‘Von der Freiheit schreiben zu dürfen’ finden sich gleichsam als Rahmen zwei Reflexionen über das Schreiben: Die den Band einleitende, von mährischem Lokalkolorit gefärbte über das zum Schreiben Kommen des Kindes und der Jugendlichen, und abschließend jene über das Schreiben als Frau und Mutter und anerkannte Schriftstellerin in Österreich. Ich bezeichne diese Texte als Reflexionen, wiewohl sie vor allem von Erlebtem berichten und in ihnen kaum abstraktes Gedankengut zu finden ist. Aber Auswahl der Elemente, Anordnung, Gewichtung und Perspektive - das zeigt nicht nur in angenehmem Erzählton Erfahrung bildende Episoden, sondern verhandelt immer wieder Wesentliches. Die Texte bersten, sobald man diese Seite an ihnen entdeckt, trotz ihrer zweifellos autobiographischen und teilweise sogar anekdotischen Anlage nahezu vor unaufdringlicher Nachdenklichkeit, einer Nachdenklichkeit überdies, die sich gegen die Einordnung in irgendwelche Systeme spreizt.
Beispielhaft, wie die Reflexion einer simplen Interviewfrage zum Doppel-Bekenntnis der Autorin führt. ‘Ich hasste das von Zeitungsleuten, Politikern, Rundfunksprechern, Reportern beinahe zu Tode geschundene Wort Identität, das in meinen Büchern nicht vorkam und ohne das ich gut ausgekommen war’, schreibt sie, um etwas später einzugestehen: ‘Es widerstrebte mir, bloßzulegen, womit ich in meinem eigenen Leben nicht zurecht gekommen war.’ Aber was macht Ilse Tielsch - und das meines Erachtens äußerst produktiv in ihrem gesamten erzählerischen Werk? Statt sich einer Definition auszusetzen oder dem Begriff eine Philosophie zu unterlegen, füllt sie diesen Fragekomplex mit Erfahrungen, bis das Wort übergeht, überschwemmt wird, von Erfahrungen aufgelöst wird. Ich lese daraus so etwas wie den Beweis, dass wir weitaus mehr von Identität verstehen, wenn wir im Konkreten der reichen Erfahrungen bleiben, und dass der Begriff verblasst, Inhalt verliert, wenn wir verallgemeinern und damit die Gegensätzlichkeit der Wirklichkeit außer Acht lassen.
Die Gegensätzlichkeit des Tatsächlichen, sie darf in diesem Buch leben. Ilse Tielsch nennt sich zwar ‘für Idylle nicht begabt’, was ohnedies wie jede Selbstdeklaration Zweifel hervorrufen sollte, beschreibt allerdings das Zusammenleben der Volksgruppen vor der Okkupation 1938 ohne jeden Hinweis auf die schon die Monarchie sprengenden Konflikte der Nationalitäten. Dass bei entsprechenden Fußballspielen die Mitglieder der deutschen wie der tschechischen Mannschaften ‘ebensooft auf dem dort massenhaft herumliegenden Gänsedreck ausrutschten’, wird wohl doch nicht alles gewesen sein. Und es ist bei den jüdischen Ernährungsvorschriften kaum zu glauben, dass die Pfarrersköchin mit der Köchin des Rabbiners wirklich Kochrezepte ausgetauscht hat. Verklärt da der erinnernde Blick auf die Jugend, verklärt da die persönliche Lebensperspektive der wahrscheinlich recht behüteten Tochter eines wohlhabenden Arztes nicht doch etwas stark? Wäre da nicht das im klugen Nachwort von Helmuth A. Niederle zitierte Eingeständnis, sie habe doch damals in ihrer Traumwelt, in ihre Bücher vergraben gelebt und habe von all dem, was um sie herum an realem Unglück passiert ist, nichts bemerkt, wäre da nicht auch in dem selben Nachwort Ilse Tielschs Appell zitiert, der eigenen Erinnerung zu misstrauen, man müsste den Satz von der Unbegabtheit für die Idylle anders lesen. So freilich achtet man diese Haltung, in der das Idyllische der Erinnerung nicht zerstört werden. die Wahrheit nicht bis zur einseitigen Korrektheit beschnitten werden muss.
Auch die in den Band aufgenommenen Dankreden für renommierte Preise gehen von einer offen dargelegten persönlichen Situation aus, indem Ilse Tielsch etwa das Bedürfnis, ja das Benötigen von Anerkennung für ihr Schreiben eingesteht. Sie entwickelt aus dieser Ausgangspointe aber fein ziselierte und höchst kundige Erinnerungen an die den Preisen namengebenden Autoren, eine wohlausgewogene Balance zwischen Sich-Einbringen und von sich Ablenken. Anders gesagt: Die Autorin ist auch in solchen Texten immerzu spürbar anwesend, verschwindet nicht hinter einer unpersönlichen Redeweise, drängt sich aber sogar dort, wo sie geehrt wird und jede Berechtigung hätte, mehr von sich zu sprechen, nicht in den Vordergrund. Und so erfahren wir durch die persönliche Sicht eine Menge über Wildgans oder die Eichendorff-Brüder und damit auch über die Autorin.
Mag die mährische Kindheit und Jugend auch für mich mit allzu schönen Farben gemalt sein, mag auch irritieren, dass über die Gründe für die Zerstörung dieses fast schon idyllischen Alltags im Herbst 1938 ‘hier nicht gesprochen werden soll’, bleibt doch die mehr als nur achtenswerte Haltung der Autorin, immerhin einer ‘Vertriebenen’. Da findet sich statt Ressentiment und Anklage ein im Wortsinn grenzenloses Verständnis für heute Entwurzelte und Flüchtlinge. Leicht zugänglich und doch weit entfernt von Anbiederung ist diese Literatur. Sie ist historische Zeugenschaft, ohne sich groß als solche auszuweisen, prall von Leben ist sie und inmitten der immer wieder durchscheinenden Schwermut der Heimatvertriebenen doch voll sanfter Zuversicht. Die Textsammlung von Ilse Tielsch wartet mit einer verwunderlichen Fülle von erlebtem Stoff auf, ohne von diesem und dem Erzählen mitgerissen weitschweifig zu werden oder vergessen zu lassen, dass Stoff in der Kunst immer dazu da ist, etwas Wesentlicheres zu zeigen. Sie ist ein Exempel, wie man ohne Geifern, ohne Kollektivschuldzuweisung und fast ohne Groll sich erinnern kann und (damit soll freilich all den Erklärungsversuchen anderorts nicht der Wert abgesprochen werden) dabei auch der Versuchung widerstehen kann, dem Unfassbaren die Unfassbarkeit zu nehmen.
Maria Hammerich-Maier
Über den Rand des Tintenfasses
Die Freiheit des Wortes hat viele Facetten. Für die Ehefrau und Mutter Ilse Tielsch bestand sie während eines langen Lebensabschnittes darin, den Mut und die Muße zu finden, um trotz doppelter Belastung und Widerständen im sozialen Umfeld den PC hochzufahren und zu schreiben. Im Jahr ihres 85. Geburtstags hält Ilse Tielsch mit dem kürzlich erschienen Buch „Von der Freiheit schreiben zu dürfen“ Rückschau. Der schmale Band vereinigt bisher nicht veröffentlichte Dankesreden, Vorträge und Aufsätze.
Den Vortrag, dem der Buchtitel entliehen ist, hat die Autorin 1989 in Brasilien gehalten. Die gebürtige Mährerin thematisiert darin die Hürden, die schreibende Frauen zu überwinden haben. „Oh ja, wir haben durchaus die Freiheit, in den Nächten aufzuholen, was uns bei Tag nicht möglich ist.“
Trotz der Anmutung einer bloß eingeschränkten Freiheit, sich als Schriftstellerin zu betätigen, hat es Ilse Tielsch zu einem stattlichen Oeuvre gebracht, das 23 selbstständige Buchpublikationen umfasst. Neben dem kontinuierlichen Strom von Lyrik, der ihre gesamte Schaffenszeit begleitet, gehört die Romantrilogie „Die Ahnenpyramide“, „Heimatsuchen“ und „Die Früchte der Tränen“ zu Ilse Tielschs bekanntesten Werken. Sie entstand in den 1980-iger Jahren und setzt sich mit der Herkunft der Autorin auseinander. Ilse Tielsch wurde 1929 im südmährischen Auspitz geboren und floh als Sechzehnjährige im April 1945 nach Österreich.
Die prägende, unwiederbringliche Kindheit, das Eins-Sein mit sich selbst über alle biographischen Bruchlinien hinweg, empfundene Heimat und Heimatlosigkeit beherrschen als wiederkehrende Themen Ilse Tielschs literarisches Werk wie auch das jüngste Buch.
„Manche ihrer Sätze haben die Qualität einer Gedankenzündkerze“, würdigt Helmut A. Niederle im Nachwort die oft frappierende Wirkung der Begriffsprägungen der Laureatin. Etwa wenn diese in ihrem Aufsatz „Gegen Intoleranz und Hass“ von einer „nationalen Flurbereinigung“ schreibt, die bereits nach dem Ersten Weltkrieg im Namen des Nationalstaates eingesetzt habe. Aus dem Modergeruch der Gräben, die in den folgenden Jahrzehnten durch Umsiedlung, Flucht und Vertreibung aufgerissen worden seien, lasse sich bis heute immer wieder politisches Kleingeld münzen. Der Präsident des österreichischen PEN-Clubs hebt die fugenlose Verlötung des Reflektierens allgemeiner Zeitumstände und persönlicher Erfahrungen im Werk Ilse Tielschs hervor.
Ilse Tielsch wirbt in ihrem literarischen Werk für Toleranz und Besonnenheit, und das sowohl beim Blick auf die Vergangenheit als auch auf die Gegenwart. Sie warnt vor dem Wiederaufleben alter faschistischer Haltungen und mahnt die Zweifelhaftigkeit dessen an, was im Gewand des Fortschritts auftritt, während es nicht selten Niedergang und neuen Heimatverlust auslöst. Sie hat, mit den Worten einer alten Redewendung, ihre Seele ins Tintenfass gesetzt, und sucht wie Heinrich Heine über dessen Rand nach ähnlich gestimmten Seelen.
Martin G. Petrowsky, Der literarische Zaunkönig, Nr. 3/2014:448-49
pdf hier: rez_petrowsky_tielsch_freiheit-schreiben_2014-3
